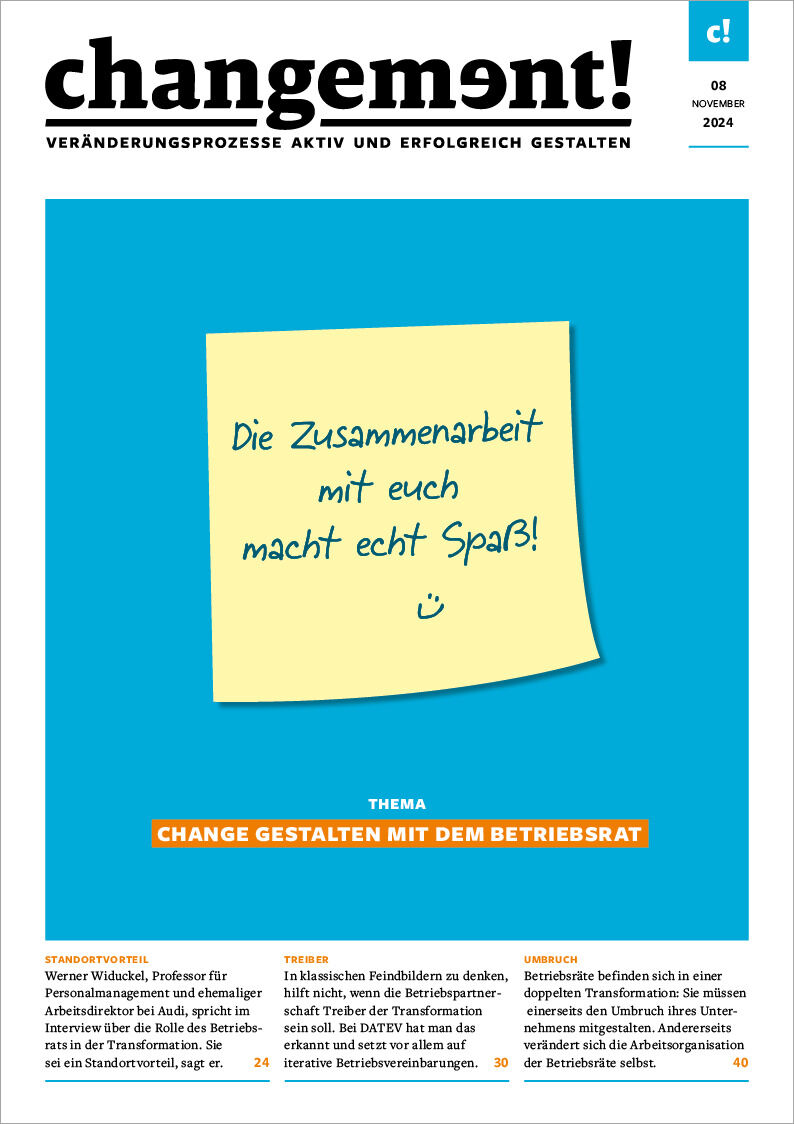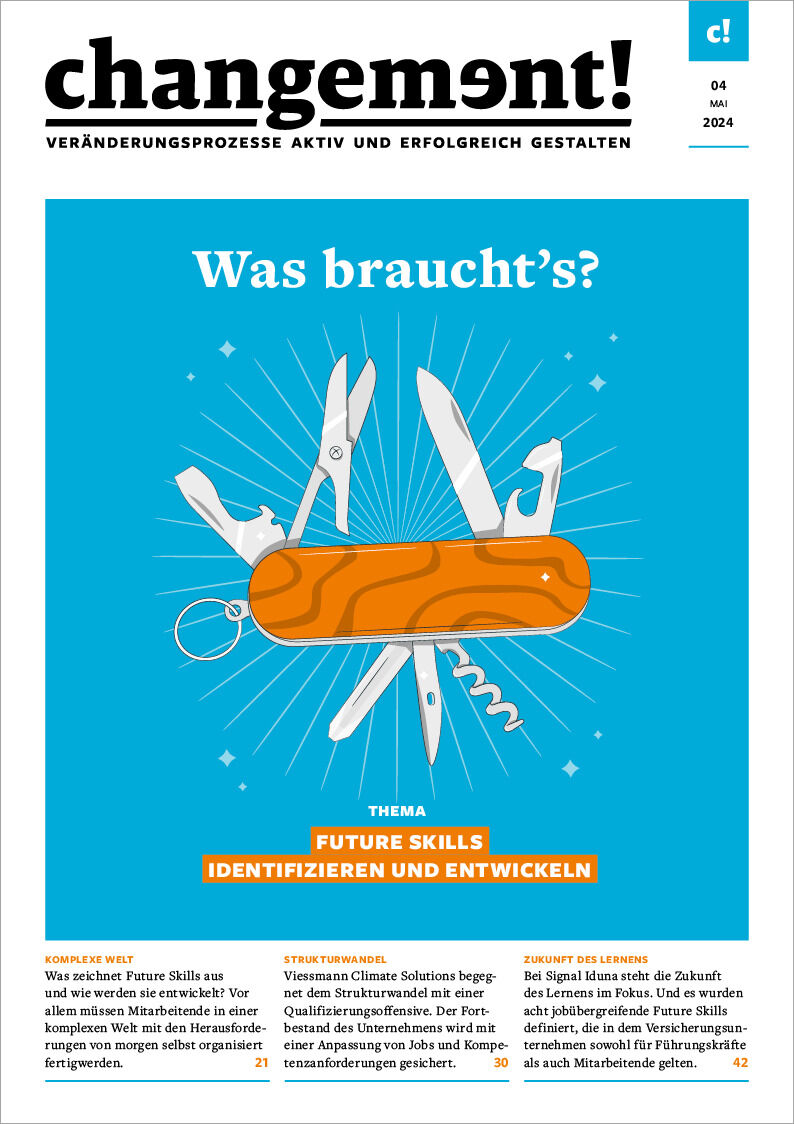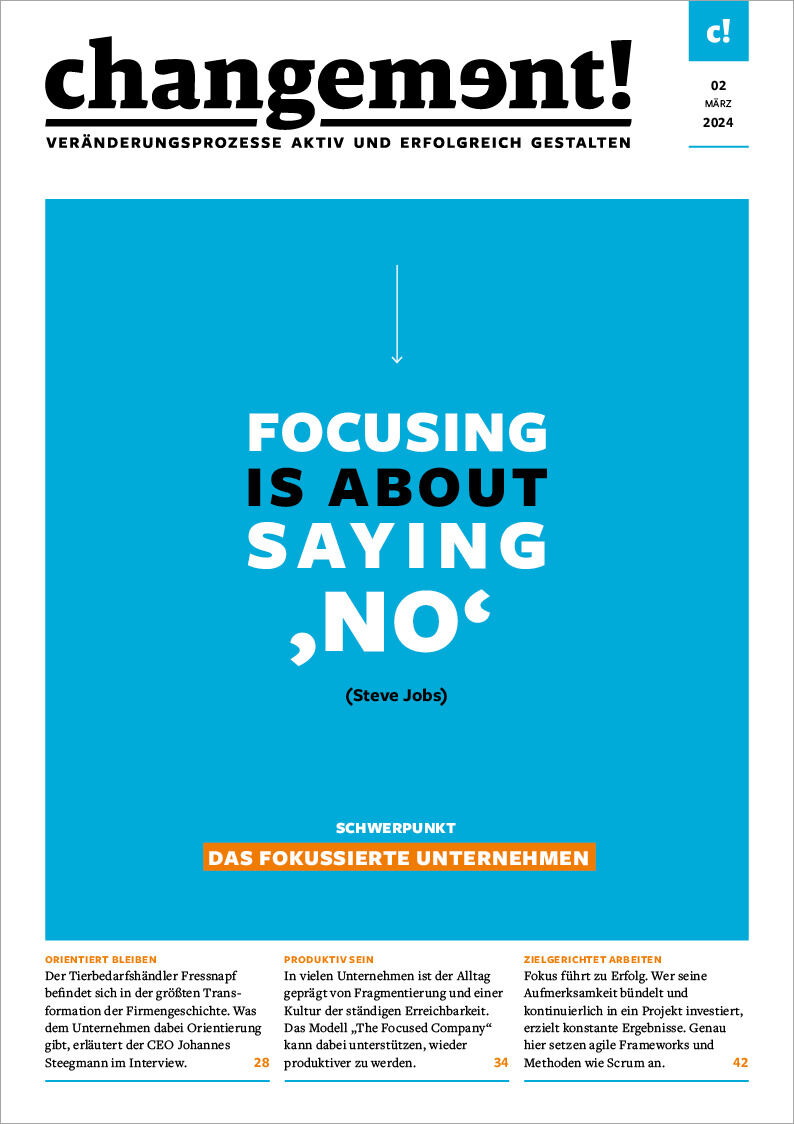Bloß nicht hundert Prozent!
Als es im März zu einer Art Lockdown gekommen ist und die Unternehmen in kurzer Zeit auf das virtuelle Arbeiten umstellen mussten, habe ich ziemlich gestaunt. Was früher unzählige Konzepte und Abstimmungsschleifen gebraucht hätte, ging im Frühling innerhalb von Tagen und Wochen. Zum Teil wechselten komplette Belegschaften in den Remote-Modus, um digital und in verteilten Teams zusammenzuarbeiten. Und es klappte bei den meisten Unternehmen erstaunlich gut. Viele, mit denen ich gesprochen habe, waren über ihre eigene Organisation verblüfft.
Das Arbeiten ist aufgrund der Corona-Pandemie mobiler, digitaler, flexibler geworden – und die Auswirkungen auf die Projekt- und Teamarbeit, die Führung, die Methoden und Prozesse sind enorm. Viele Mitarbeitende sehen die Veränderungen positiv, manche gar als eine Art Befreiung, endlich selbstbestimmter arbeiten zu können. Doch die Wahrheit ist auch, dass die berufliche und private Welt sich kaum noch trennen lassen. Der Stress ist gerade für diejenigen mit Familie größer geworden. Bei mir ist es in jedem Fall so, insbesondere dann, wenn es plötzlich heißt, dass die Kita wegen eines Corona-Falls schließen muss.
Hinzu kommt: Laut einer Umfrage des IT-Unternehmens Barco unter weltweit 1750 Arbeitnehmern fühlen sich viele durch die Trennung von ihren Kollegen negativ beeinträchtigt – sowohl emotional als auch bei der Arbeit. Rund jeder Zweite (49 Prozent) gibt an, dass die Arbeit im Homeoffice mit der Zeit weniger Spaß gemacht hat. Am attraktivsten ist für die Befragten ein hybrides Arbeitsplatzmodell. Das ideale Gleichgewicht liegt bei drei Tagen im Büro und maximal zwei Tagen pro Woche im Homeoffice. Die Hundert-Prozent-Variante des Homeoffice hat ihren Glanz verloren.
Der „New Way of Working“ ist in den meisten Unternehmen noch ein Ausprobieren. Teams sowie Organisationen müssen klären, welche Regeln sie sich hinsichtlich des virtuellen und hybriden Arbeitens geben wollen; wie sie kommunizieren und zusammenarbeiten möchten. Besonders wichtig sei es zum Beispiel, an der Inklusionskultur zu arbeiten, sagt Antoinette Weibel in dieser Ausgabe. „Verstehen, warum der oder die andere wann und wie mobil arbeitet“, gehöre dazu.
Ich bin mir sicher: Die Bereitschaft, zu solch einemoffenen und empathischen Miteinander, ist bei den meisten Mitarbeitenden da. Ich persönlich habe kein Problem damit, die Kollegen und Kolleginnen an meinen privaten Herausforderungen teilhaben zu lassen. Und wenn einer von ihnen Lust hat, einmal ein virtuelles Babysitting zu übernehmen, wäre ich dafür offen.
Jan C. Weilbacher, Redakteur